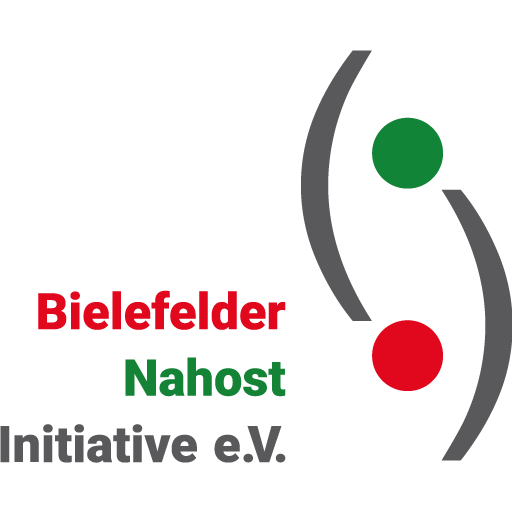Wie eine Delegation der Nahostinitiative in Zababdeh und Nahariya das zerrüttete Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern erlebt.
Bielefeld/Zababdeh/Nahariya. Schon die erste Begegnung mit Palästina ist aufrüttelnd. Schlafende Polizisten nennen die Palästinenser die Asphalt-Straßenkissen, die überall im Land dafür sorgen sollen, dass die Autofahrer nicht allzu forsch unterwegs sind. Und das sind sie hier gern. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfasst die Delegation der Bielefelder Nahostinitiative, die sich auf den Weg nach Zabadeh im Westjordanland gemacht hat. Es ist schon dämmrig, als unser Bus den israelischen Checkpoint passiert. Gleich will uns Dawoud abholen, über viele weitere schlafende Polizisten nach Zababdeh begleiten. Das 5.000-Einwohner-Städtchen in der Nähe von Jenin unterhält mit Bielefeld seit 2017 eine Projektpartnerschaft.

Ein Badeparadies am Mittelmeer: An der Strandpromenade hat sich Bielefelds Partnerstadt Nahariya mächtig herausgeputzt. | © Michael Schläger
Dawoud Shaheen ist in Zababdeh so etwas wie der Motor der Verbindung. Eine offizielle Städtepartnerschaft ist sie nicht. Die besteht mit dem israelischen Nahariya, keine 80 Kilometer Luftlinie entfernt und doch in einer ganz anderen Welt. Die großen Unterschiede zwischen Israel und dem Palästinensischen Autonomiegebiet werden wir noch oft spüren. Es ist genau das, was Dieter Becker mit dieser Reise erreichen möchte. Der emeritierte Theologieprofessor ist der Vorstandsvorsitzende der Bielefelder Nahostinitiative und hat die Delegationsfahrt organisiert. „Wir wollen auf die schwierige Situation der Palästinenser aufmerksam machen, aber auch die israelische Sicht nicht außer Acht lassen“, sagt er.
Afif Hanna hat lange in Abu Dhabi gearbeitet. Jetzt ist er zurückgekehrt und Bürgermeister von Zababdeh geworden. Auf seinem Schreibtisch steht ein goldverziertes Schild mit seinem Namen. Er beschreibt die Lage so: „Wir haben keine Bewegungsfreiheit in unserem eigenen Land. Das schränkt unsere Entwicklungsmöglichkeiten ein.“ Tatsächlich kontrollieren die Israelis das Gros der Westbank. Die Palästinenser-Gebiete bilden nur noch Enklaven.
„Palästina ist wie ein Schweizer Käse“
Bürgermeister Hanna ist Christ wie die meisten in Zababdeh. Zwar ist die Mehrheit der Bewohner des Westjordanland muslimisch, Christen besetzen aber viele wichtige Positionen. So wie Mitri Raheb, evangelischer Pfarrer und Präsident der Dar-Al-Kalima Universität in Bethlehem. Er ist Verfechter einer palästinensischen Befreiungstheologie.
Das Ziel: der Rückzug der israelischen Besatzer aus der Westbank und ein Ende der Siedlungspolitik.

Blick vom Dach der katholischen „Latin Patriachate School“ auf Zababdeh. Seit 2017 besteht eine Projektpartnerschaft mit dem Städtchen im nördlichen Westjordanland. | © Michael Schläger
„Palästina ist wie ein Schweizer Käse“, sagt er bei unserem Besuch. „Aber wir sind bloß die Löcher.“
Unsere Reise findet zu einem historischen Datum statt. Vor 75 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Überall auf den Straßen und an den Häusern dort wehen die weiß blauen israelischen Fahnen mit dem Davidstern. Die Palästinenser sprechen dagegen von der Nakba, der Katastrophe, die sich 1948 ereignete. Hunderttausende von ihnen flüchteten damals oder wurden aus dem ehemals britischen Mandatsgebiet vertrieben. Mehrere Kriege, viele Scharmützel und Terroranschläge später stehen sich Israelis und Palästinenser unversöhnlicher denn je gegenüber. „Für eine Zwei-Staaten-Lösung sehe ich kaum noch eine Chance“, sagt Steven Höfner. Die Gruppe trifft ihn in Ramallah, der Hauptstadt des Palästinensischen Autonomiegebietes. Dort leitet er das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. „Wir können nur versuchen, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen“, ergänzt er.
Shulamit Etzioni zeigt auf das historische Foto auf einem Schild an der Hatzrif Synagoge in Nahariya. „Das kleine Mädchen da, das bin ich.“ Die Frau, die jetzt Rentnerin ist, war früher für die israelischen Sicherheitsbehörden tätig. Was sie genau gemacht hat, will sie nicht verraten. Nur so viel: „Wir mussten hart für unser Land kämpfen.“
Hatzrif heißt übersetzt eigentlich Hütte. Der Holzbau im Stadtteil Neve Alon ist ein Überbleibsel aus der Gründungsphase der Stadt in den 30er Jahren. Damals siedelten sich erste jüdische Einwanderer aus Deutschland am Mittelmeer nördlich von Haifa an. Zunächst wohnten zwei Familien in der Hütte. In den 50er Jahren wurde ein Kindergarten darin untergebracht. Am Schabbat diente der Holzbau als Synagoge, und das ist bis heute so geblieben.
Rony Peled hat uns hierhergeführt, will uns zeigen, wie alles begann. Er ist Jude mit marokkanischen Wurzeln und Stadtführer in Nahariya. Rony wird von Ephraim Kende begleitet, der für die Besucher ins Deutsche übersetzt. Ephraim, Jahrgang 1938, ist in Bratislava geboren und kam als Kind ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Nur sein Großvater und er überlebten aus seiner Familie den Holocaust. „Eine bittere Zeit.“ Ephraim wanderte nach Nahariya aus, zog später nach Berlin. Jetzt ist er hier, um seinen Sohn zu besuchen. „Nahariya hat sich schön entwickelt.“ Tatsächlich erleben wir eine quirlige Küstenstadt. Seit 1980 ist sie Bielefelds Partnerstadt. Die Restaurierung von Mosaiken einer byzantinischen Kirche sind aus Bielefeld unterstützt worden. Deshalb heißt sie jetzt „Bielefeld Kirche“.
„Wir weigern uns, Feinde zu sein“
Es sind viele Widersprüche, die uns begleiten. Auf palästinensischem Gebiet werden unsere Wege überall von israelischen Überwachungskameras eingefangen. Wir sehen in Hebron, wie israelische Siedler ihren Abfall auf den palästinensischen Markt werfen, der unter ihren Häusern liegt, stehen vor der acht Meter hohen Mauer, die das palästinensische Bethlehem von Jerusalem trennt. Und wir hören von den Raketen, die in diesen Tagen aus dem Gazastreifen auf israelische Städte fliegen. Gibt es gar keinen Hoffnungsschimmer? Vielleicht steht einer wie Daoud Nasser dafür. Seit mehr als 30 Jahren kämpft seine Familie darum, dass sie ihre 42 Hektar Land südwestlich von Bethlehem behalten darf. Er betreibt dort ein Farm-Projekt und erzählt uns davon in einer Höhle, weil er auf dem Grund kein Haus errichtet werden darf. Auch Strom- und Wasseranschlüsse gibt es nicht, nur Solarzellen und Zisternen. Umringt ist das Land von fünf israelischen Siedlungen. Trotz der Hemmnisse sagt er: „Wir müssen miteinander auskommen.“ Auf dem Gelände hat er einen Stein aufgestellt. „Wir weigern uns, Feinde zu sein“, steht darauf